Ja, ich gendere. Mit gemischten Gefühlen. Was kann gendern schon ändern? Mein Denken? Mein Tun? Tue ich beim gendern nicht nur so ‚als ob‘? Als ob dadurch etwas ‚besser‘ wird? Natürlich nicht. Kann es aber etwas anregen, anstoßen? Unser Zusammenleben vernünftiger machen?
„Eingriffe in die Sprache reichen in die tiefen Schichten des Zusammenlebens hinein“, schreibt der deutsche Erziehungswissenschaftler Peter J. Brenner aktuell in einem Essay zum Gender-Thema. Tatsache ist, dass Gleichheit im Zusammenleben der Menschen bisher ein unrealistischer Wunsch ist. Tatsache ist, dass ich mich nur wohl mit anderen fühle, wenn sie nicht über oder unter mir stehen und sich nicht für besser oder schlechter, wichtiger oder wertloser halten.
Nur aus meiner Perspektive dreht die Welt sich um mich! Das ist und bleibt so lange eine Fiktion, solange mir die Vorstellungskraft fehlt, dass das gleichermaßen auch auf alle anderen acht Milliarden Menschen zutrifft. Acht Milliarden Weltmittelpunkte.
Tatsächlich geht es, wenn es um mich geht, um meine Einbettung in diesen Ego-Kosmos, der in dem Moment seinen Schrecken verliert, indem ich verstehe, dass wir ohneeinander kein brauchbares Leben miteinander führen können. Schon gar nicht ohne die Hälfte der Menschheit, für die die andere unterordnende Lebensweisen akzeptiert. Männliche Hybris ist nicht nur ein kulturelles Phänomen, sondern in einem skandalösen Maße dumm.
Gendern ist ein zu Recht umstrittenes sprachliches Mittel, um auf diesen Skandal und menschliches Handeln, das oft vor allem männliches Handeln ist, hinzuweisen und in Frage zu stellen. Im Deutschen tut das die Beidnennung, die Neutralisierung und eine Reihe von Gender-Zeichen. Leichter als gedacht geht mir in kurzen Texten gendern von der Hand. Weil ich die Lyrik liebe? In ihr ist es üblich, Gedanken und Emotionen zu verdichten, ‚Ich‘ zu sagen für ein ‚Du‘‚ für ein besseres Zusammenleben.
Die Beidnennung schreibe ich gern aus (z. B. Dichterinnen und Dichter). Die alternativen Verkürzungen durch Schrägstrich oder Binnen-I (z. B. Politiker/-innen oder PolitikerInnen) gefallen mir weniger.
Neutralisierung bedeutet, das männliche, weibliche und inzwischen anerkannte diverse Geschlecht zu neutralisieren oder zu substantivieren (z. B. Haushaltshilfe oder Mitwirkende).
Als Gender-Zeichen sind derzeit Stern, Unterstrich, Doppelpunkt und Mediopunkt (z. B. Expert*innen, Expert_innen, Expert:innen, Expert·innen) üblich. Eine Untersuchung der Duden-Redaktion und des Instituts für Deutsche Sprache im Jahr 2021 ergab, dass der Stern das am häufigsten verwendete Gender-Zeichen ist, gefolgt von Binnen-I, dem Unterstrich und dem Doppelpunkt.
Ich verwende den Doppelpunkt. Schon lange ist er Lesehilfe für zusammengesetzte Worte oder Zäsur in größeren Worteinheiten. Belege dafür reichen zurück bis ins 8. Jahrhundert v. Chr. In den Dialogen Platons grenzt der Doppelpunkt einzelne Sprechende voneinander ab.
Im Deutschen kann der Doppelpunkt vor einer Aufzählung, einem Zitat oder einer wörtlichen Rede stehen und Erklärungen und Zusammenfassungen von zuvor Gesagtem einleiten. So ist er trennend und betonend zugleich. In der Mathematik wird er als Geteiltzeichen (z. B. 4 : 8, gesprochen: 4 geteilt durch 8) und in Mischverhältnissen als Trennzeichen (z. B. 2 : 1, gesprochen: 2 zu 1) verwendet und in Uhrzeiten (z. B. 20:15 Uhr). Auch Spielstände werden durch einen Doppelpunkt getrennt (z. B. 21:17, gesprochen: 21 zu 17).
In Schweden und Finnland kann der Doppelpunkt in Preisangaben an die Stelle des Dezimalkommas treten (z. B. 3:–), im Englischen trennt er Buch und Vers in Bibel-Verweisen.
Beim gendern bettet sich der Doppelpunkt in Wörter ein: Trennendes betonend, um auf Zusammenhängendes hinzuweisen. Das ist ein gutes Zeichen!
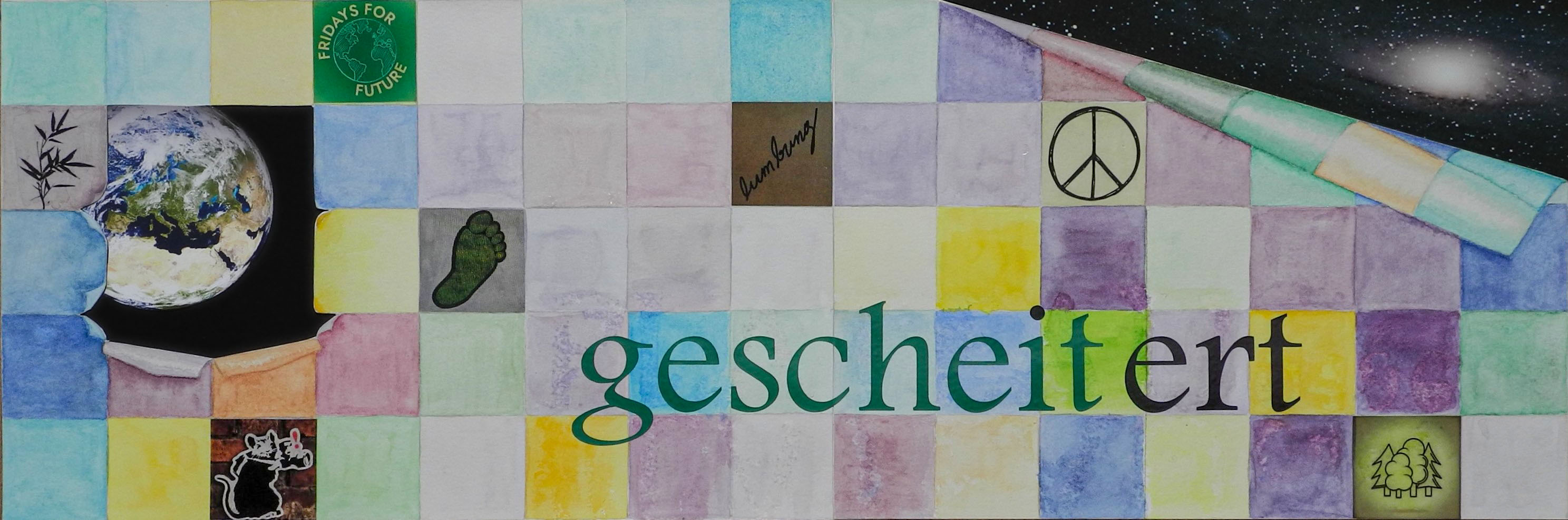
Schöne Gedanken. Leider lenkt das Gendern ab von der Tatsache, dass weiterhin Diskriminierung allgegenwärtig praktiziert wird. Tucholsky sagte einmal. Es gibt nichts Gutes – es sei denn man tut es. Ersatzhandlungen ändern nichts. Die Verunglimpfung der Deutschen Sprache hilft nicht, die Situatuion der Frauen und Mädchen zu ändern. Es ist eine wohlfeile Ersatzhandlung, um ja nicht wirklich in der Substanz mit den patriarchalischen System aufzuräumen. Soweit ich hörte, wird in England nicht gegendert.