Zehn Meter lang ist die Warteschlange vor der documenta-Kasse am Bahnhof. Viertel vor Zehn reihe ich mich ein. An den vergangenen Samstagen, höre ich, sei es ähnlich gewesen. In zwei Wochen wird die Kunst-Schau schließen, und ich bin froh, nicht bis zuletzt gewartet zu haben. Warten werde ich, stellt sich heraus, nicht nur vor diesem und jenem documenta-Haus, sondern auch darin. Auf dem Friedrichsplatz vor dem „Fridericianum“ hat sich das „Doccupy-Camp“ eingerichtet. Aktivisten der „Occupy“-Bewegung, die ihre Zelte lange vor der „Europäischen Zentralbank“ in Frankfurt aufgeschlagen hatten, haben sich im Umkreis der Kunst niedergelassen, um die Besucher der Schau gegen den Kapitalismus zu bewegen. Im documenta-Buchshop blättere ich im „Begleitbuch“ und entschließe mich, meinen Kunst-Gang nicht zu beschweren, dem eigenen Gespür zu folgen und Gedanken sich entwickeln zu lassen.
In der „documenta-Halle“ sehe ich die Maschinen-Installation von Thomas Bayrle mit ‚betenden’ Automotoren, Auto- und Autobahnfragmenten und einer riesenhaften Bildtafel mit der Fotocollage eines Flugzeugs, die 1982/83 entstanden ist. Es ist der Wandel unseres Weltbilds in den letzten Jahrzehnten, den der Berliner am Mensch-Maschine-Thema bearbeitet.
Die Südkoreaner Moon Kyungwon und Jeon Joonho arrangieren mit Film, Installation und Buchedition eine Rückschau aus der Zukunft auf die heutige Gesellschaft als Kunstwerk. Die beste Nachricht: Es gibt noch eine.
„Limited Art Project“ von Yan Lei besteht aus dreihundertsechzig (so viele Tage hat das chinesische Jahr) an Wänden und Decke oder in vertikalen Regalen untergebrachten Gemälden als ein intuitives Tagebuch. Während der Ausstellung entfernt der Künstler nach und nach die Bilder und lässt sie in einer Autofabrik in der Nähe der Stadt monochrom übermalen, um sie anschließend wieder in den Raum zurückzubringen. So soll sich der Bildkalender der Dauer widersetzen.
Mit „In Search of Vanished Blood“ hat die Inderin Nalini Malani aus fünf rotierenden Zylindern ein faszinierendes dreidimensionales Video-Schattenspiel geschaffen.
Mit einem in der Urdu-Sprache verfassten Gedicht des pakistanischen Dichters Faiz Ahmed Faiz „Das Schattenbild des Rebellen“ und zwei Erzähltexten – Christa Wolf’s „Kassandra“ und Rainer Maria Rilkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ – wird der Fluch der Sehergabe und das Scheitern zwischenmenschlicher Verständigung thematisiert. Die akustische Dimension des Projekts liefert eine Klanglandschaft, die aus Passagen von Heiner Müllers „Hamletmaschine“, Samuel Becketts „Das letzte Band“ und der Kurzgeschichte „Draupadi“ der indischen Schriftstellerin Mahasweta Devi entsteht.
Mit dem Eingesammelten gehe ich hinunter zur Orangerie. Die bedrückende Dreikanal-Videoinstallation „The Most Electrified Town in Finland“ über den Bau eines Atomkraftwerks bei der südwestfinnischen Kleinstadt Eurajoki, das 2009 den Betrieb aufnehmen sollte, jedoch wegen Planungsfehlern bis heute nicht arbeitet, bedarf keines Kommentars.
Die Sammlung des Astronomisch-Physikalischen Kabinetts ist in die dOCUMENTA (13) integriert, darunter Ölbilder, Aquarelle und Filzstift- und Kreidezeichnungen von Konrad Zuse (der, zeitgleich mit dem im Geheimen arbeitenden und lange wegen seiner Homosexualität diskreditierten Briten Alan Turing, als ‚Erfinder‘ des Computers gilt), die er zwischen 1926 und 1967 mit unverkennbarer Sympathie für Lyonel Feininger geschaffen hat.
Auf der Karlswiese vor der Orangerie hat der Chinese Song Dong „Doing Nothing Garden“ aufgetürmt, einen etwa sechs Meter hohen, von einem rotbraunen Betonring eingefassten, mit Gräsern und Pflanzen überwachsenen Abfallberg als ein Mahnmal der Zivilisation, der sich ohne weiteres Zutun ‚entwickelt’.
An anderer Stelle fixiert Massimo Bartolini mit „Wave“ in einem rechteckigen Teich eine Wasserwelle als ästhetisches Dokument eines im Zeitstrom aufbewahrten Augenblicks.
Auf den ersten Blick unglaublich ist „Idee di pietra“ von Giuseppe Penone, eine Baumskulptur als Bronzeguss, die man auch aus nächster Nähe mit der Wirklichkeit verwechselt, so perfekt ist die Täuschung, während ich die Echtheit des Felsbrockens in der Baumkrone anzuzweifeln genötigt werde. Kann ich mich denn jemals auf meine Wahrnehmung verlassen?
An Stelle des Serpentinenweges hinauf zur Schönen Aussicht nehme ich die historische Treppe. Ihr monumentaler Charakter, lese ich später, „wird noch dadurch verstärkt, dass sie ein Denkmal für die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen deutschen Soldaten bildet“. Daneben hat Natascha Sadr Haghighian einen Pfad angelegt. „Der einfache Akt, diese Stufen hinaufzugehen, wird so zu einer Gelegenheit, die Landschaft, die arkadische Natur des Parks, mit ihrem Gegenteil zu verknüpfen: den Kriegen, die das zivile Leben auf nie da gewesene Weise zum Erliegen brachten und uns seither immer wieder diejenigen Entscheidungsprozesse hinterfragen lassen, die die Geschichte der Menschheit auf immer entstellten. Die Verwüstungen, denen Männer, Frauen, Pflanzen, Bäume, Gegenstände und Gebäude ausgesetzt waren, liegen ganz buchstäblich unter diesem Abhang begraben.“ Listig verändert die Engländerin das oberflächliche Hinauf und Hinunter in ein „nicht förmlich geplantes Hindurchgehen“. Der Pfad eine Nachahmung unwillkürlich entstehender Wege, so „wie der Park die ‚freie’ Natur nachahmt“. Er funktioniert vortrefflich und wird mit Spaß und Lust in beiden Richtungen genutzt, auch weil die Künstlerin an ihm entlang von Menschen nachgeahmte Tierlaute installiert hat.
Die Gelegenheit, in der „Neuen Galerie“ Josef Beuys zu begegnen, lasse ich natürlich nicht aus. Wäre er zufrieden mit dem aktuellen Kunst-Geschehen? „Die dOCUMENTA (13) wird von einer ganzheitlichen und nichtlogozentrischen Vision angetrieben, die dem beharrlichen Glauben an wirtschaftliches Wachstum skeptisch gegenübersteht. Diese Vision teilt und respektiert die Formen und Praktiken des Wissens aller belebten und unbelebten Produzenten der Welt, Menschen inbegriffen“, heißt es programmatisch im „Logbuch“, einem Geleitbuch zur Entstehungsgeschichte der Schau. Ein kreatives Kämmerlein von Selbstverliebten ist in globaler Dynamik kaum noch zu vermitteln. „Leaves of Grass“ des Amerikaners Geoffrey Farmer zeigt die uns geschuldete Beschleunigung als einen überwältigenden Partikelrausch. Hunderte Fotos aus der amerikanischen Nachrichtenillustrierten „Life“ der Jahrgänge 1935 bis 1985 hat er in einen dreidimensionalen Raumteiler gesteckt, der mir die Rasanz buchstäblich in die Augen treibt.
 Nach dieser Überdosis von Eindrücken kann ich weder ins Alltägliche zurück noch weitergehen. Aber fortfahren! Zum Beispiel mit dem documenta-Bus.
Nach dieser Überdosis von Eindrücken kann ich weder ins Alltägliche zurück noch weitergehen. Aber fortfahren! Zum Beispiel mit dem documenta-Bus.
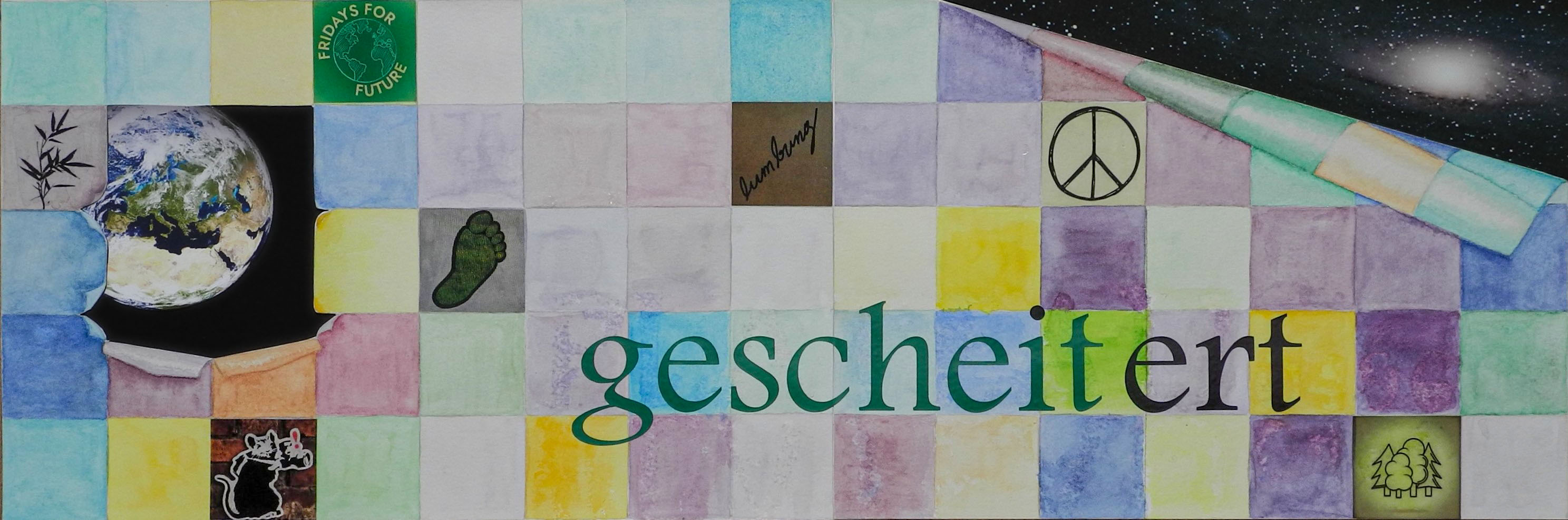
Very interesting info!Perfect just what I was searching for!Blog range