DESASTRES
Am ersten von drei Biannale-Tagen bin ich in den Giardini. Seit Anbeginn der venezianischen Kunstschauen im Jahr 1895 ist das ihr Hauptschauplatz. Angelegt wurde das Gartengelände ab 1834 im Stadtteil Santa Croce. Von meinem Quartier in Canareggio aus ist es gut mit dem Vaporetto zu erreichen. Tags zuvor mit der Eisenbahn angereist, bin ich nach einer von Mückenjagden perforierten ersten Nacht und einem akzeptablen Frühstück, das ich im Zimmer einnehmen muss, weil das kleine Hotel weder über eigene Küche noch Früstücksraum verfügt, immer noch im Modus ungeduldiger Eile. Jetzt löst der Wasserbus sie restlos auf.
Oder tun es die Wiedererkennungen entlang des Canale Grande? Die Ende des 16. Jahrhunderts über einem einzigen Bogensegment errichtete Rialtobrücke? Die elegante Armada lackschwarz glänzender Gondeln, die den Wasserbus spielend leicht umkurven? Die selbstherrliche Fassade des Palazzo Grassi, dem Ende des 18. Jahrhunderts geschaffenen letzten repräsentativen Neubau der Dogenrepublik am Kanal?
Die Accademia-Gebäude vis-à-vis dahinter, die heute ein Kunstmuseum mit der bedeutendsten Gemäldesammlung der Stadt beherbergen, bekrönen sich mit der Ponte dell’Accademia aus Holz und Stahl, die 1933 eröffnet wurde. Gleichwohl gelingt dem gründurchwirkten Uferstück mit dem Guggenheim-Museum dahinter, die gleiche Beachtlichkeit. Dann weitet sich bald der Blick auf die Lagune, bevor ihn das Ensemble am Markusplatz wieder fängt: der Campanile; die beiden Säulen mit den Stadtbeschützern San Marco in Löwengestalt und San Teodoro, dem Märtyrer; der Dogenpalast mit der Seufzerbrücke in den Gefängnistrakt, der jahrhundertelang Verliese und Bleikammern für die bereithielt, denen die Dogen den Schutz entzogen. Oder ist es der Canale Grande selbst, der mit seinem Doppelbogen die Geschwindigkeit aus der Zeit nimmt und mich auf Eindringliches vorbereitet?
Der erste nationale Pavillion – inzwischen gibt es 28 – den ich mir ansehe, ist der von Belgien. Francis Alӱs (1959) hat ihn mit „Nature of the Game“ gefüllt. Im zentralen Raum zeigen 13 Videos Kinder in aller Welt bei Straßenspielen. „Sobald ich irgendwo ankomme“, sagt der Künstler, „frage ich, wo die Kinder spielen. So komme ich einer Gesellschaft näher, ohne mich aufzudrängen“.
In diesen Spielen, die er seit 1999 dokumentiert, entdeckt er, dass gerade diese spielerischen Beschäftigungen jungen Menschen die Regeln beibringen, aus denen Empathie, Verantwortung und Selbstbewusstsein hervorgehen. Gleichzeitig bemerkt er das langsame Verschwinden dieser Spiele in den Fingerübungen auf Handy- und Tablet-Displays. In Seitenräumen bildet der Künstler auf Miniaturgemälden Momente von aktuellen Krisen und politischen Konflikten zum Beispiel im Irak, in Afghanistan, Israel oder in China ab.
Wie ein Tourgide führt Szófia Keresztes (1985) mit „After Dreams: I Dare to Defy the Demage“ durch den Pavillon von Ungarn. Eigentümlichen, von Mosaiken umhüllten organischen, teils verketteten Styropor-Gebilde, die sich über den Boden und wiederholt zur Decke hinauf schlängeln oder Durchgänge bilden, soll ich folgen und will es auch bald.
„Nach Träumen: Ich wage es, dem Schaden zu trotzen“ bezieht sich auf den 1937 erschienenen Roman „Reise im Mondlicht“ des ungarischen Schriftstellers Antal Szerb. Darin beginnt der Protagonist in Venedig seine Hochzeitsreise. Von Freund- und Leidenschaften seiner Jugend eingeholt, wird sie, mit schmerzhaften Annäherungen und Abgrenzungen, zur Selbsterkenntnis. Auch ist die von Arthur Schopenhauer 1851 veröffentlichte Parabel „Die Stachelschweine“ mitgedacht: wir Menschen als soziale Wesen, die die Gesellschaft anderer Menschen suchen, um wechselwirkend zu uns selbst zu finden. Jedoch verletzen wir uns gegenseitig umso mehr, je näher wir uns kommen …
Den Beitrag von Rumänien empfinde ich als rigorosen und zärtlichen Übergriff. „Du bist ein anderes Ich – eine Kathedrale des Körpers“ ist eine audiovisuelle Installation der Bukarester Regisseuse und Drehbuchautorin Adina Pintilie (1980). Christian (körperlich stark behindert, doch lustvoll Sexualität erlebend) und Grit, das (homosexuelle) Paar Dirk und Hermann, sowie Laura (die Körperkontakte scheut) und Hanna (eine transsexuelle Therapeutin) sind Paare, um die es geht. Bis ich bemerke, dass ich dazugehöre.
„Künstlerische Forschung“ nennt das Heft zur Biennale dieses Projekt. Jahrelang hat Adina Pintilie die sechs Akteur*innen begleitet und mit ihnen immer wieder „über die Möglichkeiten und Grenzen, Nähe zuzulassen“ gesprochen. „Als Künstlerin fragt sie, wie unsere wortlose Verständigung im Umgang miteinander eine adäquate filmische Sprache finden und auf welche Weise diese unser Miteinander prägen kann. Für den Moment verlieren wir uns in durchlässigen Projektionsflächen, die den rationalen Bau [des Pavillons] in ein Labyrinth aus Licht verwandeln: eine ‚Kathedrale für den Körper‘; einen Ort der zunächst visuellen Hingabe an etwas, das zu spüren wir noch lernen müssen.“
Den Pavillon der USA hat Simone Leigh (1967) gestaltet. Ursprünglich sollte die Ausstellung den Titel „Grittin“ tragen, ein umgangssprachlicher Begriff, der auf schützende Entschlossenheit hinweist. Kurz vor der Eröffnung der Biennale änderte sie ihn in „Sovereignty“. Außen assoziieren tief vom Dach hängendes Stroh und eine Doppelsäule aus groben Holzbalken eine Sklavenhaltervilla.
Statt eines afrikanischen Baustils bezieht die Fassade sich aber auf ein Gebäude der Pariser Kolonialausstellung von 1931, in dem eine Gruppe französischer Surrealisten gemeinsam mit der Kommunistischen Partei Frankreichs eine Gegenausstellung organisierte. Die Künstlerin nimmt diesen historischen Faden auf und verwandelt das Innere des Pavillons mit „Souveränität“ in einen Ort für die Anmut und Kraft von körperlicher Arbeit. Für die Ausführung erhielt Simone Leigh von der Jury den „Preis für den besten Beitrag in der Hauptausstellung The Milk of Dreams“.
„Die meisten Menschen werden meine Arbeit nicht mögen“, vermutete der Künstler und Musiker Marco Fusinato (1964) vorab. Der hohe Hauptraum im Pavillon von Australien ist überwiegend leer. Linkerhand erstreckt sich eine weiße Bildwand vom Boden bis unter die Decke. Davor, seitlich versetzt, bilden im rechten Winkel dazu 12 große und 6 kleinere Lautsprecherboxen eine schwarze Tonwand.
Einzig farbig im Raum ist ein gerahmtes 400 Jahre altes kleines Gemälde an einer Stirnwand, ein Memento mori, erwarb Fusinato bei einer Online-Auktion. Es wurde sein Maskottchen für diesen Raum.
Als der Künstler ihn betritt, sitze ich auf einer von wenigen gegenüber der Bildwand aufgestellten Transportboxen. Er nimmt eine bereitgestellte E-Gitarre, setzt sich der Bild- und Tonwand abgewandt aber mit Blick auf das Gemälde und ‚füttert‘ mit Gitarre und verschiedenen Effektpedalen eine Soundmaschinerie, die wiederum mit Bild- und Tonwand gekoppelt ist.
„Desastres“ – in Anlehung an die Grafik-Folge „Desastres de la guerra“ von Francisco de Goya – heißt die Performance, die Marco Fusinato mehrmals täglich an sechs Wochentagen über die gesamten 200 Biennale-Tage zeigt. Der Rechner synchronisiert mit Bildwiederholfrequenzen die teilweise über meine Wahrnehmungsfähigkeit hinausreichen, tausende von eingespeicherten monochromen Standbilder in Graustufen mit den vom Künstler erzeugten Klängen und Geräuschen. Doom Metal wird ein Anfang der 1970er Jahre entstandener Sound genannt, dessen Erfindung der Band Black Sabbath zugeschrieben wird. „Doom“ steht für „Unheil“ und „Verhängnis“.
„Desastres“ ist „ein experimentelles Lärmprojekt, das Ton und Bild synchronisiert“, sagt Marco Fusinato. „Ich verwende eine E-Gitarre als Signalgenerator, um Geräuschblöcke, gesättigte Rückkopplungen und unharmonische Intensitäten zu improvisieren, die eine Flut von Bildern auslösen. Die Bilder stammen aus einer Reihe von Wörtern, die in eine offene Suche auf mehreren Online-Plattformen eingegeben wurden.“ Die Blder zeigen geometrische, irdische und kosmische Motiven, menschengemachte Katastrophen und Bürgerproteste und Szenen von Gewalt, Folter und Blutvergießen.
Erbarmungslos dringen sie in mich ein, nehmen den Atem, dröhnen in den Eingeweiden wie ein gewaltiges Naturerbeben und der Befürchtung, mich aufzulösen. Das geschieht jedoch nicht. Weder Marco Fusinato, der mir die Dröhnung verabreicht, noch mir, den die hochfrequenten Bilderfolgen zu zerstückeln drohen. Weil meine Beine mich in Sicherheit gebracht haben – auf die Terrasse vor dem Eingang – bevor der Master of Desaster drinnen kontrolliert zur Ruhe kommt. Die finde ich auch draußen lange nicht, dann den Gedanken, dass das Ganze eine Hinterlist erst wäre, wäre es kein KunstWerk.
„Score“ nennt Marco Fusinato die vehementen Ton-Bild-Faltungen im Raum. „Ich bin immer auf der Suche nach etwas, das ich nicht quantifizieren kann; es ist ein Gefühl. Und dann finde ich es vielleicht und habe es eine Weile. Das kann einen weit bringen.“ Ins Universum? In die Klapse? Ins Grab?
Die Basstöne bleiben, erreichen mit mir die entlegensten Winkel der Giardini. Lautstärke und Bildfrequenz kann Fusinato steuern, sagt er, die Auswahl der Bilder nicht. Ich muss an aktuelle Diskurse über KI denken, wenn er sagt, er verstehe sein Instrumentarium nicht vollständig, wisse nie wirklich, wie die Kontrolleinheit auf seine Improvisation reagieren wird und wolle das während der Biennale-Tage lernen.
Die Eltern des Künstlers waren Bauern in einem Dorf der Provinz Belluno, etwa 100 Kilometer nördlich von Venedig. Bevor sie 1960 nach Australien auswanderten, bewirtschafteten sie Land mit Eseln. Vier Jahre später wurde ihr Sohn geboren. Die Sprache seiner Eltern, bellunisch, ist in Italien so gut wie verschwunden. „Wenn ich nach Venetien zurückkomme“, sagt er heute, „ist es, als käme ich aus der Vergangenheit“. Taxifahrer brächen, wenn er bellunisch mit ihnen spricht, in Tränen aus. Das bringt mich nahe. Ihm und mir.






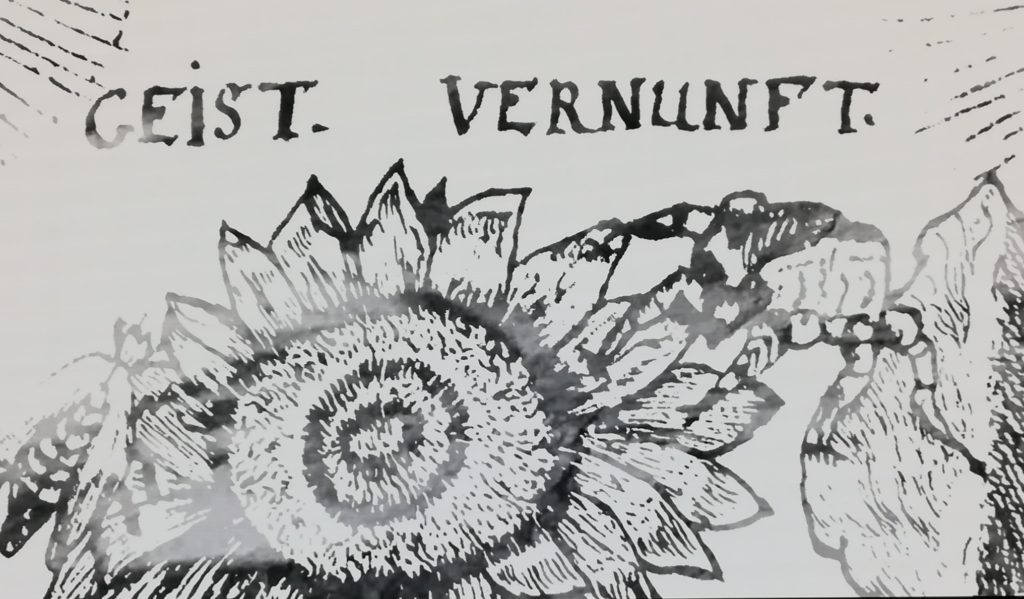
Very interesting details you have observed, appreciate it for posting.Blog range