In der Kindheit und Jugend gibt es Erlebnisse, von denen wir erst im Rückblick merken, dass sie unser weiteres Leben beeinflusst haben. Sie bilden die Knoten in jenem virtuellen Netz, das unser Gehirn in seiner dunklen Knochenhöhle knüpft, um uns zu fangen, zu halten, z verstricken. Für mich gehören die Aufenthalte im Schullandheim Grüneberg zu diesen Erlebnissen.
Im September 1963 war ich nach der achten Klasse auf die „Erweiterte Oberschule“ („EOS“) mit der Abiturstufe gewechselt. Die „EOS Philanthropinum“ in Dessau wurde 1774 von dem deutschen Pädagogen und Schriftsteller Johann Bernhard Basedow als eine Erziehungs- und Bildungsanstalt für Söhne des Adels und wohlhabender Bürger eröffnet. Seine neuen Lehrmethoden fanden damals in ganz Europa Beachtung. Nicht zufällig geschah das in der Regierungszeit des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau. Er hing der Aufklärung an und formulierte den Anspruch, dass Schönes nützlich und Nützliches schön sein soll. Erziehung und Bildung sollten das verbreiten.
Das ehemalige Forsthaus Grüneberg in der Gemarkung der Gemeinde Gödnitz im Kreis Zerbst hatte die Schule 1960 erworben, um es zum Schullandheim auszubauen. Es sollte helfen, die jährlich neuen Schulklassen zu guten Gemeinschaften zu entwickeln.
„Die Ausstattung wurde bewusst einfach gehalten, um den hohen Belastungen durch die Belegungen standhalten zu können“, schrieb der Pädagoge Günter Klages, damals verantwortlich für das Heim. „Einen Hausmeister gab es nicht. Lehrer und Schüler arbeiteten mit großem Engagement an der Verbesserung der Ausstattung und des Objektes. Alle Arbeiten wurden in Eigeninitiative erbracht, einen staatlichen Fonds für das Heim gab es nicht.“
„‚Grüneberg‘ – ein schöner Name / Berge weit und breit nicht da. /Aber das spielt keine Rolle, / denn wer dieses Häuschen sah, / fühlt sich immer hingezogen“, dichtete eine Mitschülerin 1967 für unsere Abizeitung. Lehrer Klages schrieb: „Alle Versorgungsleistungen mussten von den Schülern selbst erbracht werden, das reichte vom Heizen über das Bereiten des Mittagessens für 30 Personen bis zur großen Abschlussreinigung.“ Verringert hat das unser Wohlbefinden nicht, auch nicht die vormittäglichen zwei oder drei Unterrichtsstunden in den Fächern des Klassenlehrers.
Auf sie verzichtete der unsere bei meinem ersten Aufenthalt in Grüneberg für einen Vortrag über Astronomie. Astronomie war erst in der 12. Klasse Schulfach aber schon seit der 8. Klasse mein Hobby. Das hatte er erfahren und gefragt, ob ich an einem der Tage statt seiner Chemie und Biologie den Mitschülern etwas über Sonne, Mond und Sterne erzählen wolle.
Erstaunt und überrumpelt hatte ich „ja“ gesagt. Noch nie hatte ich zwei Schulstunden lang zu einem Thema gesprochen. Vor Aufregung vergaß ich eine Pause und ebenso die vielen vorbereiteten Zettel. Weil ich das, was ich sagen wollte, wie man heute sagen würde, „drauf hatte“ und das Universum schon im Kopf. Das muss in dem Moment nicht nur mich beeindruckt haben, denn anschließend hatte ich für den Rest der Schulzeit den Spitznamen „Professor“ weg.
Nicht minder heftig erging es mir im Schullandheim mit der neuartigen Beatmusik. Jemand hatte für einen Plattenspieler gesorgt und ein Mitschüler verschiedene Singles der „Beatles“, „Kinks“, „Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich“, an die er durch einen Kontakt nach Westberlin gekommen war, mitgebracht. Es muss noch vor dem legendären Konzert der „Rolling Stones“ gewesen sein, wobei die „Waldbühne“ zerlegt wurde, die Westpresse von einem „Gemetzel der Gammler“ schrieb und Walter Ulbricht, Staatschef der DDR, im Politbüro seiner Partei anordnete, „mit der Monotonie des Je-Je-Je und wie das alles heißt“ Schluss zu machen. Dass es um mehr als Neumodisches ging, ahnte ich da.
Beidem, dem Vortrag über das Universum und der überwältigenden Rockmusik, verbunden mit diesem Ort, schreibe ich gern den Abschied von der Kindheit zu.
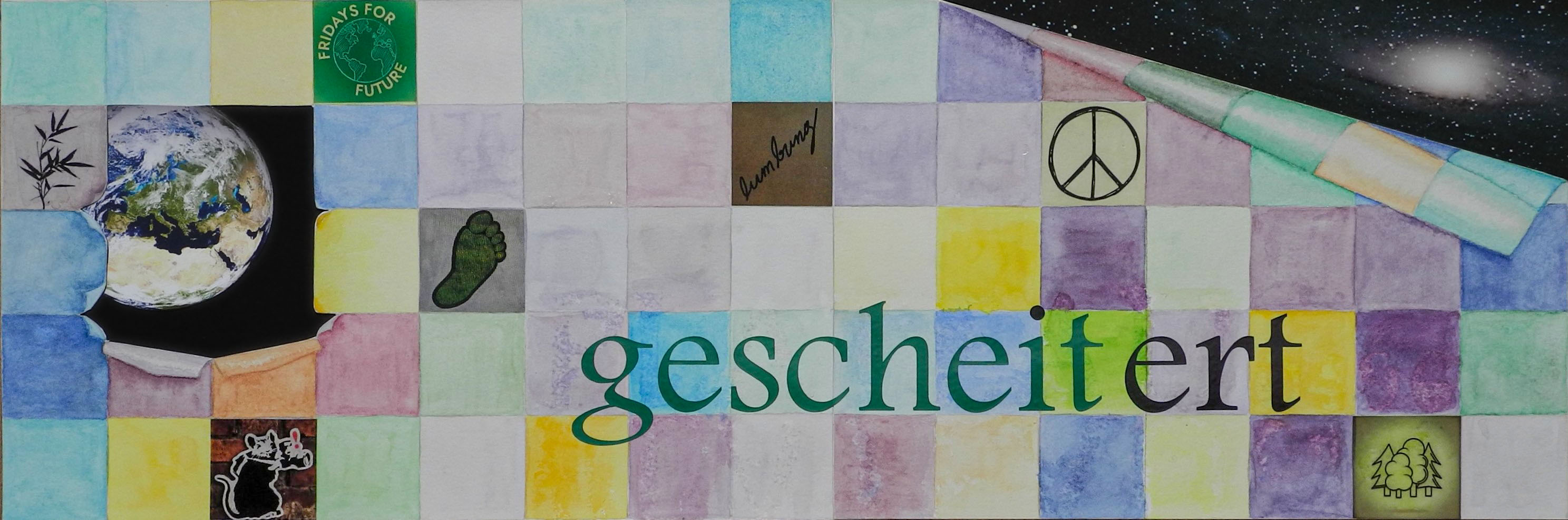
Well-written and concise. Great job.