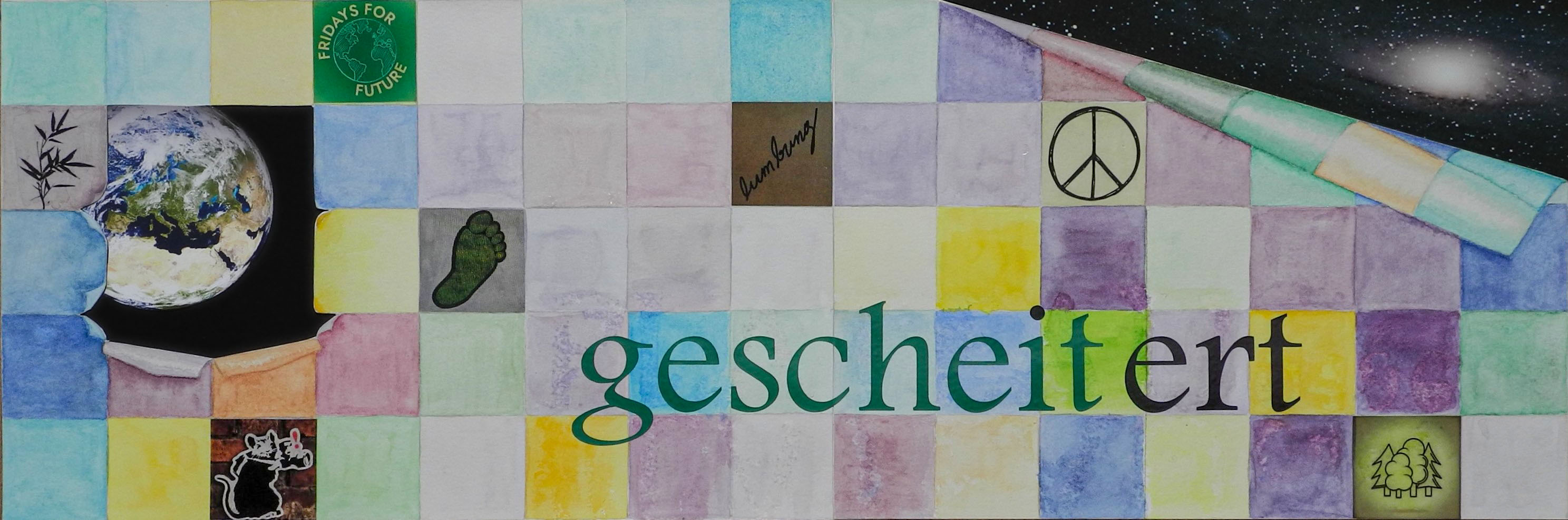Seit ich feststelle, dass ich nicht bleiben muss, wie und wo ich bin, gibt es kein Zurück. Was aber soll ich tun, seit ich weiß, dass ich nicht noch einmal von vorn anfangen kann? Dass das eine Illusion ist. Soll ich deswegen Bisheriges über Bord werfen? Soll ich Demut üben? Ziele vermeiden? Wege umgehen? Schluss machen? Womit?
Meine Suche nach Antworten ist eine Suche nach Worten, die mich in eine andere Richtung führen, in eine Gegend, wo ich mit mir und der Welt zufrieden sein kann. Auch eine Illusion? Wenn nicht, inwieweit steht das in meiner Macht? Wie weit reichen Kraft und Mut, meinen Fuß so auf die Erde zu setzen, dass ich bleibe und sie begehbar bleibt? Welchen vernünftigen Grund hätte ich, sie kugeloberflächenplatt zu treten? Warum tue und tue und tue ich das? Bis sie mit mir umgeht zuletzt. Auf ihre Weise.
Eines Tages lief mir der „Fuß aus Stolz“ über den Weg, ein langes Lied auf einer CD des Liedermachers Gerulf Pannach. Das war 1998. Aus dem zugehörigen Booklet erfuhr ich, dass es sich um einen nachgedichteten Song von Bob Dylan handelt. Der Dylan-Experte Tony Attwood nennt „Foot of Pride“ in einer Rezension auf dem Internetportal bob-dylan.org.uk/ „seltsam“.
Wie ein Pfeil fährt ein Blitz durch einen Mann, / und seine Frau kriegt’s mit der Angst; sie hat auch zu top gelebt und sie sagt: / ‚Papilein!‘ beim Begräbnis und ein Stoßgebet. / Der Priester warnt davor, dass man Christus verrät. / Da sieht man wieder, was die Erde macht: / Wer zu hoch hinaus will, der kommt schnell wieder herab. / Oh, weißt du, was man zu den netten Leuten, die auf dem Weg nach oben sind, sagt: / ‚Früher oder später sehen wir uns alle wieder im Grab!‘ //
Oh, es gibt kein Zurück / wenn der Fuß aus Stolz abstürzt / gibt es kein Zurück. //
So dichtete Pannach die erste Strophe und den Refrain nach. Seltsames konnte ich darin nicht finden. Vielleicht ist eine Beerdigung der geeignete Anlass für solche Gedanken? Ich hörte den Song das erste Mal nach Pannachs Beerdigung, auf der ich war, weil ich ihn kannte. Im Frühjahr 1998 hatte der Krebs ihn knapp vor seinem 50. Geburtstag abgefangen, erbarmungslos. Danach besorgte ich mir die CD „G. Pannach. YORCK 17“, auf der er „Foot of Pride“ wie ein Fazit auf sein absehbares Ende ausruft.
Tony Attwood schreibt, dass Dylan den Song etwa vierzig mal und in verschiedenen Stilen aufnahm, „als ob er sich nicht entscheiden konnte, was er damit machen sollte“. Keine Version soll ihm gefallen haben. Hat sein musikalisch-literarisches Genie nicht ausgereicht, die ungewöhnlichen Versmaße und wuchernden Binnenreime mit der einfachsten Formel der Pop-Musik, dem 12-Takt-Blues-Format, zu bändigen? Aber genau das hat er sich zugemutet und die alte Blues-Sequenz zu einem Kunstwerk imperfekter Perfektion ausgedehnt.
Sechs Strophen sind dafür nötig, die mehr als neun Minuten dauern und so schnell vorbei sind. „Und ich frage mich, wie es sein kann, dass Bob so etwas nie in einem Konzert aufgeführt hat. Allein die Art und Weise, wie er die Refrains singt, ist unglaublich kraftvoll.“
Pannach lässt den Fuß aus Stolz im Refrain der Reihe nach, abstürzen, abhauen, abdrehen, eintreten, aufgeben und zutreten. Alles in allem. Alles in einem. Wie in den besten Nachdichtungen kommen seine Worte und Bilder Dylan an nächsten, wenn er auf sich von der wörtlichen Übertragung des Originals entfernt, um sich darin zu finden. So macht er sich und Dylan mir verständlich.
Seine Personnage ist in der zweiten Strophe „‘ne Dame namens Carmen“, in der dritten „ein Geschäftsmann aus Berlin“, in der vierten „Joan Baez auf dem Weg zu Schweizer Banken“. In der fünften Strophe treffe ich auf „Leute, die verdammt worden sind, weil sie sich nahmen, was ein anderer sich nahm. Mal war es eine Frau, mal zu viel Absinth, manchmal auch das Leben, weil es darauf überhaupt nicht mehr ankam“. In der letzten werde ich ermahnt: „Wenn du zuhörst, hör nicht auf, auf dich zu hör’n! Keiner hat die Wahrheit je gefunden, weil er höher stand, kein Politiker, kein Zwei-Meter-Mann, kein Volksredner“.
So schleicht sich Wirklichkeit in den Song, die sich dem guten Tony Attwood leider nicht erschließt: „Letztendlich widert Dylan das Verhalten der Menschheit als Ganzes und einzelner Mitglieder an, wie wohl auch die meisten von uns, und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich wichtig ist, was Bob genau sagt.“ So redet jemand, der sich vergeblich um einen Zugang bemüht hat. Meinen Respekt hat er, weil er das eingesteht und sich nicht herauswindet. Stattdessen fügt er eine weitere Rezension vom Internetportal www.allmusic.com hinzu:
„‚Foot of Pride‘ wurde ursprünglich 1983 für die Infidels-Sessions aufgenommen und ist einer der explosivsten und giftigsten Songs, die Dylan je geschrieben hat. Seine Texte und Verse sind voll kraftvoller Bilder. Typisch für seine Songs in dieser Zeit ist die Vermischung von Spirituellem mit Weltlichem. Im Wesentlichen ist es ein moralistisches Lied über die vielfältigen Verfehlungen des Menschen, und der Refrain ist eine Warnung. Der Künstler selbst hat das Lied nie live in einem Konzert aufgeführt, obwohl Lou Reed beim Bob Dylan 30th Anniversary Concert (im August 1993; P.M.) eine zu Recht berühmte Interpretation davon ablieferte und dabei die halb gesprochenen, halb gesungenen Verse meisterhaft darbot.“
Pannachs Darbietung hält sich auf Augenhöhe.