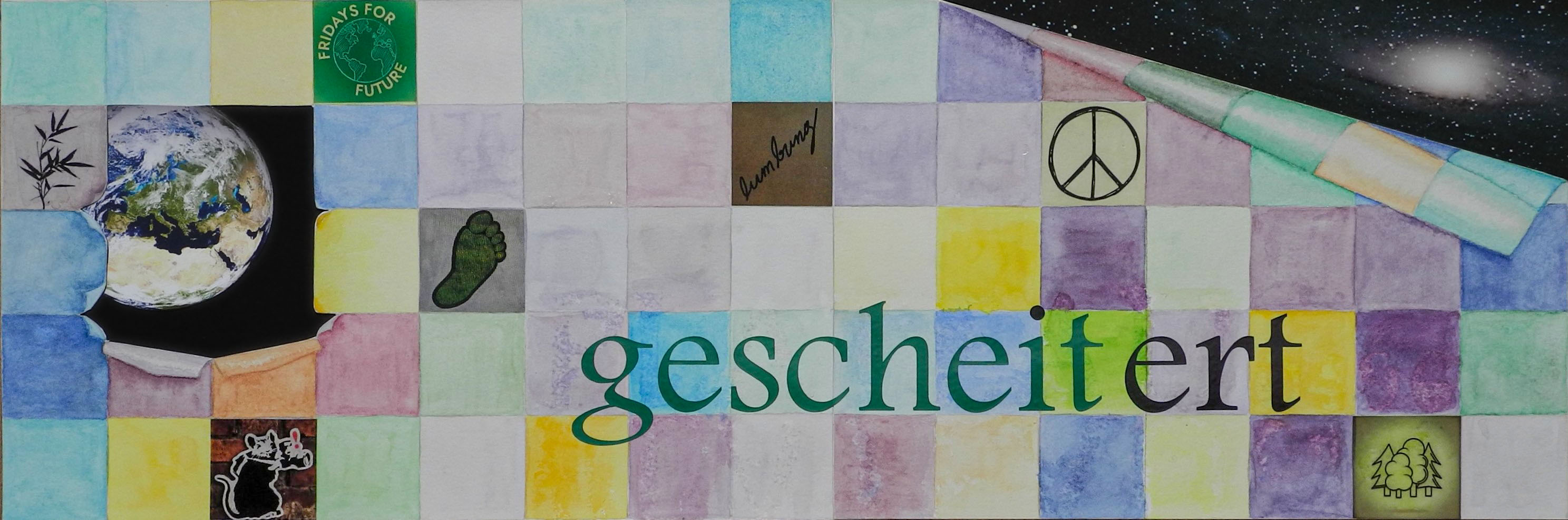Im Juni 1995, zu Christos Lebzeiten, fuhr ich eines Nachts im Auto nach Berlin, um im Sonnenaufgang den in jenen Tagen von ihm und seiner Frau Jeanne-Claude verhüllten Reichstag zu erleben. Der Journalist Hanno Rauterberg nennt das Ereignis heute eine „schöne, funkelnde Vermessenheit“, mit der Christo „die Macht des Faktischen“ überwunden habe „und allen vor Augen führte, was Kunst und Demokratie unbedingt brauchen: ein Denken, das über sich selbst hinausweist“. Klingt gut, ist aber so weit an des Pudels Kern vorbei wie die naive Absicht, den Planeten retten zu müssen. In uns steckt er nämlich drin, dieser Kern und nicht im Irgendwo um uns herum . Um unsere Rettung geht es und was wir dafür tun können: so leben, dass wir bleiben. Um nicht mehr. Um nicht weniger.
Drei Stunden später, wieder in Mölkau, das Leipzig sich damals noch nicht einverleibt hatte, schrieb ich in mein Tagebuch, wie „beeindruckt von der Wirkung des verhüllten Monuments“ ich war, und wie es sich „mit einem Mal hervorhebt im Widerschein der Hülle“.
Heute, wieder im Juni, bin ich in der Abenddämmerung in Berlin, um zu sehen, wie Christos Neffe Vladimir Yavachev auf der Westfassade des Reichstags allein mit Licht an das Ereignis vor 30 Jahren erinnern will. Sein Onkel, der 1956 im bulgarischen Gabrowo zur Welt gekommene Christo Wladimirow Jawaschew und die am selben Tag im marokkanischen Casablanca geborene Jeanne-Claude Denat de Guillebon, mit der er lebenslang zusammen war, begegneten und verliebten sich 1958 in Paris. Da hatte Christo schon die Idee der Verhüllung, die prägend für die Kunst der beiden wurde.
Ihr erstes gemeinsames Projekt, das sie 1962 verwirklichten, war eine Barrikade aus Ölfässern, zu der sie die Berliner Mauer inspirierte. Damit wollten sie eine Seitenstraße in Paris versperren. Als die Behörden das untersagten, blockierten sie unerlaubt die Rue de Visconti und heirateten, last but not least, am Ende jenes Jahres.
Die Verhüllung des Reichstagsgebäudes, das zwischen 1884 und 1894 im Stil der Neorenaissance im Ortsteil Tiergarten am linken Ufer der Spree entstand, beschäftigte die beiden lange 23 Jahre. Seit 1988 hatten sie in der damaligen Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth eine wichtige Unterstützerin. Entschiedene Gegner des Projekts waren Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble, die die Verhüllung des deutschen Nationalsymbols als Kränkung empfanden. 1994 überstimmte sie der Deutsche Bundestag in einer namentlichen Abstimmung mit 292 Ja- und 223 Neinstimmen bei 9 Enthaltungen.
So wie ein Liebesgedicht, so wie jeder kreative Akt, sind Christos und Jeanne-Claudes Verhüllungen politisch: in gesellschaftlichen Kontext eingebunden. In Berlin brachte ihr Projekt „den Apparat der Demokratie an seine Grenzen“, schreibt Hanno Rauterberg und ließ „wie nebenher das Selbstbild einer Gesellschaft aufscheinen, die ungemein stolz war auf ihre Liberalität, sich aber mit der eigentlich recht simplen Idee eines Künstlers ungeheuer schwertat“.
Persönlichen Schaden, anders als bei so vielen politischen Ereignissen, erlitt daran niemand, doch allein der Vorgang des Verhüllens reichte weit über das mediale Interesse hinaus. Etwa fünf Millionen Menschen erlebten vor Ort, wie nach und nach der gewichtige Baukörper unter 10 000 Quadratmetern feuerfesten Polypropylenstoffbahnen, überzogen mit einer Aluminiumschicht, zusammengenäht und von 90 professionellen Kletterern und vielen weiteren Helfern mit 15 600 Metern Seil an der Fassade befestigt wurden, wie er dadurchalle Schwere verlor, die ganze lastende Geschichte. Ohne – und hier wird es genial – tatsächlich zu verschwinden. Das war viel besser als jeder faule Zauber, der bloß hinters Licht führen will, nie hinein.
1995, als die ersten Sonnenstrahlen auf die Verhüllung fielen, hellten nicht nur die Gesichter derer auf, die schon so früh am Tag auf den Platz gekommen waren, sondern auch ihr Bild der Welt dahinter, das sich draußen zu einer feierlichen Stimmung zusammenfügte, die alle, ungeteilt mitnahmen, woher sie auch gekommen waren. Wir hatten uns verwandelt, nicht das Gebäude. Das war der Zauber.
Und jetzt, im Abendlicht, das schwindet und die bewegte Projektion minütlich deutlicher zutage bringt? Bringt sie den Zauber wieder? Bewegend das Nachempfundene so wie das Original? Das zu erwarten, wäre auch naiv, doch ist das, was zu sehen ist, auf jeden Fall auf Augenhöhe und breitet wieder eine stille Aufmerksamkeit aus, mit der ich mich nach einer Stunde fortbewege, anders als ich gekommen bin.

Christos und Jeannne-Claudes Verhüllung war stringent und von sanfter Konsequenz. Sie ließ nichts außen vor und nichts blieb frei als Raum für meine Sinne. „Jetzt hingegen, unter den Lichtschleiern der Projektoren, können die Säulen, Fenster, Skulpturen nicht einfach abtauchen. Sie bleiben, was sie sind, auch wenn es manchmal aussieht, als kräuselten sich davor ein paar Tücher und der Wind führe hinein, um die parlamentarische Gegenwart einmal zu durchlüften.“
Das ist nicht wenig, denke ich, und: mehr ist nicht zu erwarten, nicht von Licht und Luft, nicht in dieser Stadt und nicht vom Geist der Zeit oder Christos.